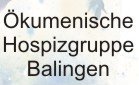Von Sören Stiegler 02.07.2019 - 19:00 Uhr
Balingen. „Ich wollte einfach nicht sterben. Ich wollte weiterleben. Und habe alles dafür getan”: Als Ilse Binder 2007 an Brustkrebs erkrankte hat sie den Kampf aufgenommen. Sie habe das Gefühl gehabt: Es ist noch nicht Zeit. Sie sagt, sie wollte wissen wie alles weitergeht, auch mit ihrem Sohn. Es ging weiter. Sie konnte die Krankheit besiegen. Seit einigen Monaten ist sie Oma. Und schon längere Zeit hilft sie Menschen dabei, Mut zu fassen, für das Lebensende. Ilse Binder ist seit fast elf Jahren ehrenamtliche Sterbegeleiterin.
In der einschneidenden Zeit ihrer Krankheit, während der Gedanken an das eigene Lebensende plötzlich sehr konkret wurden, fasste die 72-jährige Weilstettenerin einen Entschluss: „Wenn ich das überstehe, dann will ich was machen, was anderen weiterhilft.” Sie begann 2008 die Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin bei der Ökumenischen Hospizgruppe Balingen – eine 60-stündige Qualifizierungsmaßnahme, die unter anderem dazu befähigen soll, Gespräche mit Sterbenden zu führen und an deren Ende sich ein Praktikum anschließt. Hierbei wird ein erfahrener Ehrenamtlicher bei seinen Besuchen und Gesprächen begleitet. „Für diesen Dienst kann man sich erst entscheiden, wenn man das mal mitgemacht hat und weiß, welche Fragen alte Leute haben und wie sie auf ihr Ende zugehen”, sagt Ilse Binder.
Bis zum letzten Schritt
Zwischen zehn und 15 Menschen hat sie inzwischen auf deren Weg in den Tod begleitet. Manche bis zu drei Monate lang. Sie beschreibt diesen Weg bildlich – als Trittsteine, die über einen Flusslauf führen. Die Sterbenden werden hinüber geleitet, aber den letzten Schritt müssen sie alleine tun: „Wir alle gehen diesen Weg. Müssen ihn gehen. Und in vielen Fällen: dürfen.” Es gibt Leute, erzählt Binder von ihren Erfahrungen, die warten auf den Tod: „Wenn man die besucht, dann hat man den Eindruck, dass sie auf Erlösung warten. Sie fragen sich: ›Warum muss ich noch da sein? Ich habe mein Leben gelebt.‹” Binder nennt das „lebenssatt”. Die Hospizgruppe betreut die sterbenden Menschen ambulant, in Pflegeheimen oder zuhause. Ilse Binder kümmert sich um Erwachsene, oft alte Menschen. Für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen ist eine andere, eigene Ausbildung nötig. Erst einmal habe sie erlebt, dass eine Person jünger als sie gewesen sei – eine krebskranke Frau. Die habe sie daheim besucht. Die Menschen wünschten sich oft, zuhause sterben zu dürfen.
Im Grunde sei es gar nicht viel, was Sterbende benötigen, erzählt Binder. Viele wollten einfach nur reden: „Über die Familie, die Krankheit oder was ihnen im Leben wichtig war, was sie erlebt haben.” Es sei wichtig, einfach nur da zu sein: „Manche Menschen können auch nicht mehr reden. Dann frage ich: ›Darf ich Ihre Hand halten? Soll ich ihnen etwas vorlesen?‹” Oft legt sie ihre Hand auch einfach nur auf deren Oberarm: „Es beruhigt die Leute zu wissen, dass sie nicht alleine sind.”
Sie habe noch nie erlebt, dass jemand zum Ende hin übermäßig mit seinem Schicksal gehadert habe: „Ich habe den Eindruck, dass die Leute gefasst dem Tod entgegen gehen.” Sie seien zuversichtlich und beruhigt gewesen: „Die Personen mit denen ich zu tun hatte, hatten eine gewisse Erwartung. Dass danach noch etwas kommt. Dass nicht einfach nur alles zu Ende ist.”
Sie halte sich nicht für einen „Super-Christen”, sagt die 72-jährige und lächelt. Aber Christin sei sie, und auch als Christin habe man Zweifel an bestimmten Dingen: „Ich stelle mir nicht den Himmel vor. Ich weiß nicht, wie es danach weitergeht. Aber inzwischen glaube ich, dass nach dem Tod noch was kommt.”
Das eigentliche Sterben eines Menschen hat Ilse Binder noch nicht erlebt. Der Übergang vom Leben in den Tod geschieht oft ganz alleine: „Viele Menschen nutzen die Abwesenheit von Angehörigen, um zu sterben. Um sie nicht zu belasten.” Der Zeitpunkt sei oft sehr unerwartet. Wenn sie Bekannten von ihrer Arbeit erzählt, dann fragen die Leute oft erstaunt: „Wie schaffst du das? Ich könnte das nicht!” Und natürlich dürfe man das alles nicht zu nahe an sich rankommen lassen. Während der Fahrt nach Hause verarbeitet sie das Erlebte. Und sie spricht mit ihrem Mann darüber. „Aber da geht es jeder Krankenschwester nicht anders.”
Ihr Mann wird im nächsten Jahr 80 Jahre alt. Sie weiß nicht, wie sie seinen Tod verarbeiten würde. Aber ihr Ehrenamt hat ihr geholfen, den Tod als etwas Natürliches zu sehen: „Der Tod gehört zum Ende des Lebens, so wie die Geburt an den Anfang.”
Es sei wichtig für die Gesellschaft, über den Tod und das Sterben zu sprechen. Auch deshalb wird sie zusammen mit drei anderen am Sonntag, 7. Juli, beim Diakoniegottesdienst zur Gemeinde sprechen und kurz von ihrer Arbeit erzählen (siehe Info). Das landesweite Motto des Diakoniegottesdienstes: „Unerhört! Diese Alltagshelden.” Es sollen Menschen im Mittelpunkt stehen, die oftmals im Stillen wirken und dennoch großes Leisten.
(Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Schwarzwälder Boten. Redakteur und Bild: Sören Stiegler)